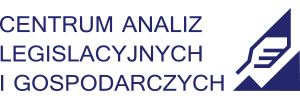Männlich, weiblich und divers in der deutschen Rechts- und Amtssprache
Schon seit mehr als vierzig Jahren wird in aller Öffentlichkeit darüber herumdiskutiert und -gestritten, ob das Deutsche eine geschlechtergerechte Sprache ist. Während die einen der Überzeugung sind, dass der deutschen Sprache nichts vorzuwerfen sei, vertreten die anderen die Ansicht, dass es unentbehrlich sei, am Deutschen einige Veränderungen vorzunehmen, weil diese Sprache keinesfalls die Möglichkeit gebe, die Existenz mehrerer Geschlechter sprachlich zum Ausdruck zu bringen.
Die sprachliche Benachteiligung hängt oft mit dem androzentrischen Sprachgebrauch zusammen. Die androzentrische Ersetzungsregel besagt, dass maskuline Personenbezeichnungen – generische Maskulina – neutral seien und selbstvertretend für die Bezeichnung aller Geschlechter verwendet werden dürften.[1] Die vermeintliche sprachliche Benachteiligung von nicht-männlichen Personen soll in der Rechtssprache vehement zum Vorschein kommen, in der bis heute fast ausschließlich das Maskulinum Singular gebraucht wird, woran die feministische Sprachwissenschaft Kritik übt.[2]
Zurzeit entstehen viele Ratgeber und Leitfäden, die vor allem die Gebrauchsgewohnheit des generischen Maskulinums kritisieren. Bundesverwaltungsämter, Universitäten, verschiedene Firmen und Institutionen wollen mit derartigen Texten, anderen dabei behilflich sein, ihre Texte geschlechtergerechter zu gestalten, d. h. sie zu gendern. Gendern sei ein sprachliches Verfahren, um Gleichberechtigung im Sprachgebrauch zu erreichen. Es bedeutet somit die Anwendung von Ausdrücken, die die im Grundgesetz formulierte Gleichberechtigung von Frauen und Männern besser abbilden würden.[3] Im Folgenden wird die Stellung des generischen Maskulinums in der Rechts- und Amtssprache diskutiert.
Generisches Maskulinum in der Rechtssprache
Zunächst ist zu betonen, dass der Gebrauch des generischen Maskulinums in der Rechtssprache den Regelfall darstellt, weil das generische Maskulinum die Form ist, der man sich beim Bezug auf männliche, weibliche und diverse Personen sowie gemischte Personengruppen bedient.[4] Alle nicht-männliche Personen würden dabei mitgemeint bleiben.[5] Die feministische Sprachforschung weist darauf hin, dass es beim derartigen Gebrauch des generischen Maskulinums dazu kommen kann, dass Zweifel daran besteht, an wen sich die jeweilige sprachliche Äußerung richtet oder wer gemeint ist. Als Beispiel kann das folgende Dilemma angeführt werden. Wenn jemand sagen würde: ,,Frau X ist die beste Assistentin, die ich je hatte“ oder: ,,Frau X ist der beste Assistent, den ich je hatte“, wäre es kaum festzustellen, ob die genannte Frau X die beste von allen Frauen oder die beste von allen Frauen und Männern ist.[6]
Mit der Frage der Neutralität von generischen Maskulina setzte sich der Bundesgerichtshof auseinander, der sich nicht auf die Seite der 80-jährigen Marlies Krämer schlug, welche darauf pochte, Sparkassenformulare in weiblicher Form zu bekommen, weil das generische Maskulinum sie als Frau nicht umfasse.[7] Durch die Anwendung einer weiblichen Form sollte in Krämers Augen die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ausgedrückt werden, die in der Verfassung formuliert ist. In diesem Fall lag eine unzulässige Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Absatz 2 Satz 1 GG nicht vor, weil aus einer unmittelbaren Anknüpfung an das Geschlecht einer Person keinerlei Diskriminierung erwuchs.[8] Allein aus der grammatikalisch weiblichen Ansprache wird einer Person keine weniger günstige Behandlung zuteil.[9] Maskulina in der Rechtssprache haben es nicht zur Aufgabe, auf das biologische Geschlecht hinzuweisen. Zugegebenermaßen gelten maskuline Nomina als Oberbegriffe für beide Geschlechter, sie stehen aber zeitgleich in der Opposition zu femininen Nomina. Dies ist einer der Gründe, warum das generische Maskulinum im Kreuzfeuer der feministischen Sprachkritik steht und warum geschlechtergerechtere Formulierungen gefordert werden.
Gendern in der Rechtssprache
Die Einführung von gegenderten Formen in die Rechtssprache würde zwangsläufig dazu führen, dass man neue Formen für alle erdenklichen Fälle ausdenken müsste, die sich bei der Geschlechterzuordnung ergeben würden. Daraus resultiert die Frage, wie Personen anzusprechen sind, die sich keinem der bereits anerkannten Geschlechter zugehörig fühlen. Die Geschlechterdifferenzierung beschränkt sich nicht mehr auf die Wahl zwischen Mann und Frau, was das Bundesverfassungsgericht im Oktober 2017 entschieden hat.[10] Hierbei ist zu beachten, dass Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen lassen, vor Diskriminierung wegen ihres Geschlechts durch Art. 3 Absatz 3 Satz 1 GG geschützt werden.[11] An der Stelle ist ebenfalls zu betonen, dass eine Form, die alle berücksichtigen würde, bereits existiert: Das wäre eben das generische Maskulinum. Die Formulierung neuer Formen könnte das Geschlecht in den Fokus rücken, obwohl das Geschlecht durch die Verwendung geschlechtergerechter Formen im Prinzip nicht zum Vorschein kommen sollte. Die feministische Sprachwissenschaft pocht jedoch darauf, Formulierungen zu schaffen, die keinen sexistischen Ursprung hätten, was der Fall beim generischen Maskulinum ist, von dem weibliche Personenbezeichnungen abgeleitet werden.
Das Aufnehmen von gegenderten Formen in die Rechtssprache wird auch dadurch verhindert, dass bisher keine eindeutigen Regeln zum Gendern weder erstellt noch offiziell angenommen worden sind. Zum einen empfiehlt der Rat für deutsche Rechtsschreibung, alle Menschen dadurch sensibel und respektvoll anzusprechen, dass man sich der entsprechenden geschlechtergerechten Formulierungen und Anredeformen bedient. Zum anderen betonte der Rat in seiner Sitzung am 26. März 2021, dass Sonderzeichen sowie Großbuchstaben im Wortinneren, die beim Gendern verwendet werden, zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen werden.[12]
Gendern in der Amtssprache
Die sprachliche Benachteiligung von nicht-männlichen Personen ist auch mehrmals im Bundestag zur Debatte gestellt worden. Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung vom 24. Juli 1991 einen Beschluss gefasst, der auf diesen Antrag von Fraktionen der CDU/CSU und FDP vom 11. Mai 1991 zurückgeht:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, ab sofort in allen Gesetzentwürfen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften geschlechtsspezifische Benennungen/Bezeichnungen zu vermeiden und entweder geschlechtsneutrale Formulierungen zu wählen oder solche zu verwenden, die beide Geschlechter benennen, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist und Lesbarkeit und Verständlichkeit des Gesetzestextes nicht beeinträchtigt werden.“[13]
Der Antrag hat mit Sicherheit die deutsche Gesetzgebung beeinflusst, weil er einen Beschluss erzwungen hat, der die Amts- und Verwaltungssprache zum Gerechteren geändert hat:
,,Die Bezeichnungen, die auf die Silbe »-mann« enden, wie z. B. Ersatzmann, Wahlmann, Vertrauensmann, sollten durch andere Bezeichnungen ersetzt oder um entsprechende Bezeichnungen, die auf die Silbe »-frau« enden, ergänzt werden. Auch die Vorschriften, die die Gestaltung und Wortwahl für Formulare, Urkunden, Dokumente etc. festlegen, sind auf die Personenbezeichnungen hin zu überprüfen (…) Schematisch anzuwendende Lösungen, wie z. B. die durchgängige Verwendung von Paarformeln (der Käufer oder die Käuferin) oder die Verwendung des großen I (der/die Antragstellerln) werden abgelehnt.“[14]
Die Sprachexperten, die sich 1991 mit der Geschlechtergerechtigkeit der deutschen Rechtssprache auseinandergesetzten, betonten, dass die von feministischen Sprachforscherinnen vorgeschlagenen Lösungen die Verständlichkeit des Rechtes verwischen würden und dass feminisierte Texte nicht mehr deutlich seien und sich nicht mühelos lesen ließen. Im Kern sehe es vor, dass die Gesetzmäßigkeiten des Deutschen klar seien und der Gebrauch des generischen Maskulinums die Rechtsanwendung auf keinerlei Weise infrage stelle.[15] Der Beschluss hat immerhin in gewissem Maße ein Brandmal in der Vorschriftensprache eingebrannt. Der Bundestag empfahl 1992, auf die Verwendung der generischen Formen zu verzichten, wenn es der Lesbarkeit und Verständlichkeit nicht entgegensteht.[16]
Schanzenbächer verweist darauf, dass sich die Verpflichtung zur Verwendung des generischen Maskulinums in der Rechts- und Amtssprache aus dem Verfassungsrecht nicht ergibt. Die gegenderten Formulierungen sind aber in der Amtssprache zugelassen worden, weil sich staatliche Einrichtungen explizit an ein Individuum richten. Die Tatsache, dass man die korrekte geschlechtsspezifische Anrede gebraucht, resultiert aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.[17]
Fazit
Seit den 90er Jahren setzt man alle Kräfte daran, dass nicht-männliche Personen beim Lesen eines Gesetzes sofort sichtbar sind und dass sie sich mitgemeint fühlen. Es wird empfohlen, sich des generischen Maskulinums nur in der Situation zu bedienen, wo andere Formulierungen den Inhalt der jeweiligen Vorschrift in den Hintergrund drängen könnten. Die Versuche, die Sprache geschlechtergerechter zu machen, dürfen die Übersichtlichkeit von Texten nicht verwischen. Zugleich sollten feminisierte Formulierungen die Rechtschreibregeln nicht verletzen, nicht gekünstelt wirken und dem natürlichen Sprachgebrauch tunlichst nah sein. Die Pflicht, in der Rechts- und Amtssprache zu gendern, ergibt sich aber aus dem Verfassungsrecht nicht.
Bibliografie
Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, 99. Auflage, 2002.
Janisch, Wolfgang, Urteil zu Gendersprache. BGH verpasst eine Chance auf Fortschritt, in: ,,Süddeutsche Zeitung“, Zugang am 28.12.2022.
Leisi, Ernst, Leisi, Ilse, Sprach-Knigge: oder wie und was soll ich reden?, Berlin 2016.
Maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache. Bericht der Arbeitsgruppe Rechtssprache vom 17. Januar 1990, 12/1041.
Der Rat für deutsche Rechtsschreibung, Die Entwicklung und Bewertung des Themas ,,Geschlechtergerechte Schreibung“in der Beobachtung des Schreibgebrauchs 2018-2020, gebilligt am 26.03.2021.
Samel, Ingrid, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft, Berlin 1995.
Schanzenbächer, Matthias, Gendern als verfassungsrechtliche Verpflichtung? Rechtsgutachten im Auftrag der Theo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache, 2002.
Steinhauer, Anja, Duden – Richtig gendern, Berlin 2017.
[1] Samel I., Einführung in die feministische Sprachwissenschaft, Berlin 1995, S. 57.
[2] Samel I., Einführung in die feministische Sprachwissenschaft, Berlin 1995, S. 57.
[3] Steinhauer A., Duden – Richtig gendern, Berlin 2017, S. 5.
[4] Steinhauer A., Duden – Richtig gendern, Berlin 2017, S. 27.
[5] Steinhauer A., Duden – Richtig gendern, Berlin 2017, S. 27.
[6] Leisi E., Leisi I., Sprach-Knigge: oder wie und was soll ich reden?, Berlin 2016, S. 80.
[7] Janisch W., Urteil zu Gendersprache. BGH verpasst eine Chance auf Fortschritt, in: ,,Süddeutsche Zeitung“, Zugang am 28.12.2022.
[8] Dürig/Herzog/Scholz/Langenfeld, 95. EL Juli 2021, GG Art. 3 Abs. 2 Rn. 25.
[9] Schanzenbächer M., Gendern als verfassungsrechtliche Verpflichtung? Rechtsgutachten im Auftrag der Theo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache, S. 5, 2022.
[10] BVerfGE 147, 1, 28.
[11] Schanzenbächer M., Gendern als verfassungsrechtliche Verpflichtung? Rechtsgutachten im Auftrag der Theo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache, S. 7, 2022.
[12] Der Rat für deutsche Rechtsschreibung, Die Entwicklung und Bewertung des Themas ,,Geschlechtergerechte Schreibung“ in der Beobachtung des Schreibgebrauchs 2018-2020, gebilligt am 26.03.2021.
[13] Maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache. Bericht der Arbeitsgruppe Rechtssprache vom 17. Januar 1990, 12/1041.
[14] Maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache. Bericht der Arbeitsgruppe Rechtssprache vom 17. Januar 1990, 12/1041.
[15] Maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache. Bericht der Arbeitsgruppe Rechtssprache vom 17. Januar 1990, 12/1041.
[16] Schanzenbächer M., Gendern als verfassungsrechtliche Verpflichtung? Rechtsgutachten im Auftrag der Theo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache, S. 8.
[17] Schanzenbächer M., Gendern als verfassungsrechtliche Verpflichtung? Rechtsgutachten im Auftrag der Theo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache, S. 18(9).
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.